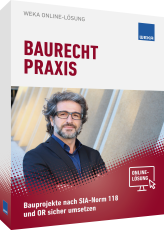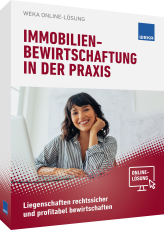Bauherr: Kontrolle und Haftung

Passende Arbeitshilfen
Art. 679 ZGB gilt für den Fall, dass ein Grundeigentümer sein Eigentumsrecht überschreitet. Wer dadurch geschädigt oder mit Schaden bedroht wird, hat das Recht, auf Schutz vor Schaden oder Schadenersatz zu klagen. Diese Haftung besteht auch bei Schädigungen Dritter infolge der Bauarbeiten. Der Bauherr haftet kausal, also auch dann, wenn ihn kein Verschulden trifft. Das gilt auch für Schäden, die durch Handlungen seiner Beauftragten, wie zum Beispiel Architekt, Bauunternehmer oder Handwerker, verursacht werden. Ein Rückgriff auf die beigezogenen Fachleute ist in der Regel nur dann möglich, wenn diese schuldhaft gehandelt haben.
Zusätzlich zu der Grundeigentümerhaftung gilt auch das Nachbarschaftsrecht nach Art. 684 ZGB.
Schädigt der Bauherr durch Bauarbeiten auf dem Grundstück ein Nachbar, z.B. durch Immissionen oder Erschütterungen, kann dieser mit seiner Schadenersatzforderung direkt zum Bauherr gelangen. Er muss weder den eigentlichen Verursacher kennen noch dem Bauherrn ein Verschulden beweisen können. Nachzuweisen sind lediglich die Schadenexistenz und der ursächliche Zusammenhang zwischen Schaden und Bauarbeiten.
Nach Art. 58 OR hat der Eigentümer eines Gebäudes oder eines anderen Werks den Schaden zu ersetzen, der infolge von fehlerhafter Anlage oder mangelhaftem Unterhalt entsteht. Als solche gelten beispielsweise ungesicherte Schächte und Gruben, schadhafte Treppenstufen und losgelöste Dachziegel. Art. 58 OR begründet eine strenge Kausalhaftung, die allerdings in den letzten Jahren durch Gerichtsurteile etwas gemildert wurde.
Der Bauherr ist oberster und letzten Endes gesamtverantwortlicher Projektleiter. Durch eine angemessene Kontrolle kann er das Risiko von unvorhergesehenen Schadenfällen reduzieren und den Bauablauf durch gezielte Massnahmen mit dem Architekten oder Unternehmer sicherstellen. Er muss dafür sorgen, dass die Baupartner ihre vereinbarten Pflichten und Aufgaben richtig erfüllen! Unterlässt er das, besteht die Gefahr, dass er in einen Rechtsstreit oder in einem Schadensfall mit dem Vorwurf der Fahrlässigkeit oder gar Grobfahrlässigkeit verwickelt wird.
Die Kontrolle, ob die Normen, Qualitäten, Mengen, Masse, Leistungen, Termine etc. den vertraglichen Vereinbarungen entsprechen, sollte durch einen Baufachmann laufend erfolgen. Die wichtigsten Aufgaben einer Bauherr -Kontrolle sind mit dem Architekten oder dem für die Bauleitung verantwortlichen Vertreter einer Total- oder Generalunternehmung zu besprechen und zu vereinbaren. Die Baubewilligung mit den zugrunde liegenden Plänen, Skizzen, Auflagen und übrigen Schriftstücken sowie der bereinigte Kostenvoranschlag bilden die Grundlagen.
Passende Produkt-Empfehlungen
Bereits beim Angebotsvergleich sind die Qualitäts-, Mengen- und Preiskontrollen unerlässlich. Noch wichtiger werden sie während der Ausführung. Man muss prüfen, ob man wirklich das erhält, wofür man zahlt. So ist beispielsweise die Kontrolle der Betonqualität sowie der Armierung unerlässlich, auch im Hinblick auf die Werkhaftung. Für die Kostenüberwachung verwenden die Fachleute ein Instrument, das in verschiedenen Varianten existiert, aber immer ähnlich aufgebaut ist. Es trägt unterschiedliche Bezeichnungen: Kostenstatus, Kostenkontrolle, Finanzrapport und weitere mehr. Man kann dabei in Einzelheiten gehen oder eine pauschale Überwachung durchführen. Die Kosten der Bauausführung werden mit dem Kostenvoranschlag verglichen.
- Die Kurzfassung der Baukostenüberwachung sollte im Rhythmus von etwa einem Monat an die Bauherrschaft abgegeben werden. Mit den heutigen technischen Hilfsmitteln kann man die Kostenüberwachung sogar ohne weiteres tagesaktuell führen.
- Bei der detaillierten Kostenüberwachung werden für alle Arbeitsgattungen detaillierte Informationen über Zahlungen, Nachträge, Rückstellung und dergleichen überprüft. Dabei werden auch allfällige Mehr- und Minderleistungen und Bestellungsänderungen ausgewiesen sowie Rückstellungen vorgenommen. Es ist sinnvoll, dass der Bauherr die detaillierte Kostenüberwachung etwa alle drei Monate erhält.
- Der Bauherr sollte beide Kontrollen, so weit als möglich, nachvollziehen und mit den Vorgaben des bereinigten Kostenvoranschlages sowie der Dienstleistungs- und Werkverträge vergleichen.
Die Ausführungs- und Terminkontrolle sind im Architekten- oder TU- bez. GU-Vertrag zu regeln, der Bauherr muss aber laufend über deren Einhaltung wachen.
Als Beweismittel können Fotos oder Videoaufnahmen der Baustelle mit einer konventionellen oder einer Digital-Kamera nützlich sein. Wegen der digitalen Manipulierbarkeit ist die Beweiskraft der letzteren im Streitfall allerdings noch umstritten.