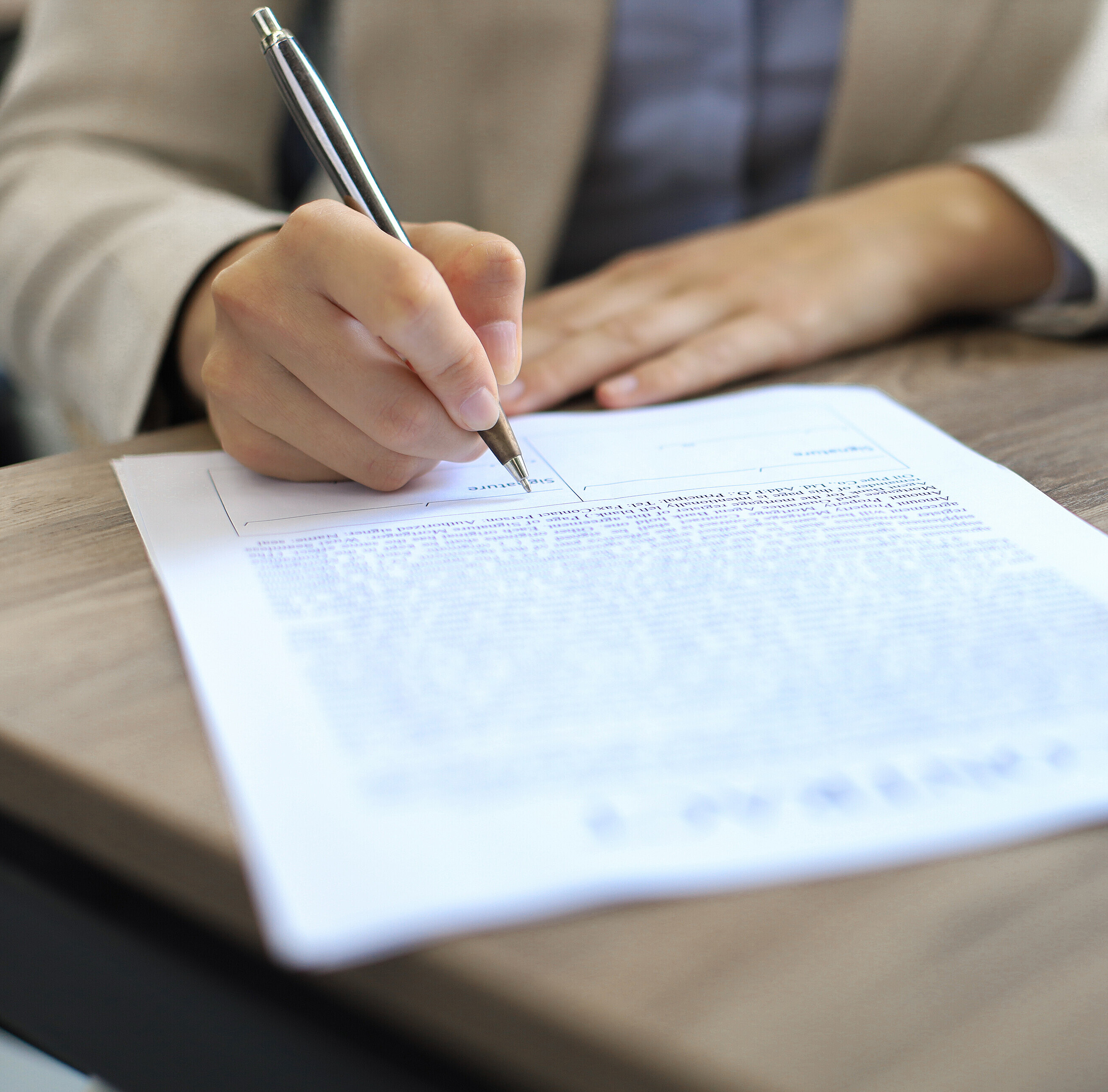Darlehen an Aktionäre: Fallstricke aus rechtlicher und steuerrechtlicher Sicht

Passende Arbeitshilfen
Aktienrechtliches Verbot der Einlagenrückgewähr
Das Aktienkapital einer Gesellschaft stellt das Haftungssubstrat für deren Gläubiger dar. Bei Dividendenausschüttungen ist stets zu beachten, dass diese «eiserne Reserve» nicht angetastet wird. Die Rückzahlung des Aktienkapitals in direkter oder indirekter Form, ohne Liquidation der Gesellschaft, ist unter dem Titel der Einlagenrückgewähr aktienrechtlich nicht zulässig. Darüber hinaus nehmen verschiedene Konstellationen wie etwa nicht marktgerechte Darlehen und Kontokorrente zugunsten des Aktionärs die Form einer faktischen Dividende an, welche zu steuerlichen Konsequenzen führen.
Bundesgerichtsentscheid: Fallstricke bei Darlehen an Aktionäre
Das Bundesgericht verschärfte in einem Entscheid von Mitte Oktober 2014 seine Praxis zum Verbot der Einlagenrückgewähr, wonach Forderungen zwischen Aktionär und seiner Gesellschaft oder innerhalb von Konzerngesellschaften – wie Darlehensgewährungen oder Kontokorrentguthaben – nur zu marktgerechten Konditionen gewährt werden dürfen. Im Umkehrschluss werden alle Forderungen, die nicht zu marktüblichen Konditionen gewährt werden, als faktische Dividendenausschüttungen betrachtet.
Zur Veranschaulichung ist an einen im eigenen Handwerkerbetrieb mitarbeitenden Aktionär zu denken, der von seiner Gesellschaft ein Darlehen für den privaten Hauskauf erhält. Hier stellt sich die Frage, ob der Handwerker das Darlehen zu marktgerechten Konditionen gewährt wird.
In der Praxis ist entscheidend, ob die kreditgebende Gesellschaft einem Dritten ein Darlehen zu gleichen Konditionen anbieten würde. Fehlende Bonität des Darlehensnehmers, ungenügende Sicherheiten, keine Vereinbarungen über die Rückzahlung, ausstehende Rückzahlungen, Umwandlung des Darlehenszinses in eine Darlehensschuld usw. sprechen eher für unübliche Marktkonditionen.
Passende Produkt-Empfehlungen
Wird die Forderung unter Berücksichtigung aller Umstände als nicht marktgerecht qualifiziert, kann die Steuerverwaltung die Darlehensforderung als faktische Dividendenausschüttung behandeln – mit der Folge, dass unter Umständen der gesamte Betrag der Verrechnungssteuer und den Einkommenssteuern unterliegt.
Darüber hinaus sperren diese faktischen Dividendenausschüttungen gemäss der neuen Bundesgerichtspraxis das frei verfügbare handelsrechtliche Eigenkapital einer Gesellschaft. Ist bei einer effektiven oder faktischen Dividendenausschüttung nicht mehr genügend frei verfügbares Eigenkapital vorhanden, wird nach der Argumentation des Bundesgerichts das Haftungssubstrat der Gesellschaft geschmälert. Dies stellt folglich einen Verstoss gegen das zivilrechtliche Verbot der Einlagenrückgewähr dar. In der Folge können die Aktionäre auf privatrechtlicher Basis unter Umständen gezwungen werden, Dividendenausschüttungen zurückzuerstatten. Allenfalls wäre der Dividendenbeschluss selber nichtig, und es stellen sich Haftungsfragen der Organe.
Fazit zu Darlehen an Aktionäre
Zusammenfassend muss die Gesellschaft in der vorliegenden Thematik sicherstellen, dass Darlehens- und Kontogewährungen an den Aktionär stets zu Marktpreisen erfolgen. Andernfalls drohen Konsequenzen auf Stufe der Einkommens- und Verrechnungssteuern. Darüber hinaus wird mit einer derartigen faktischen Dividende unter Umständen gegen das handelsrechtliche Verbot der Einlagenrückgewähr verstossen.
Quelle: Dieser Beitrag stammt aus dem Informationsmagazin für KMU «MEMO», Ausgabe 35, der Gewerbe-Treuhand AG.