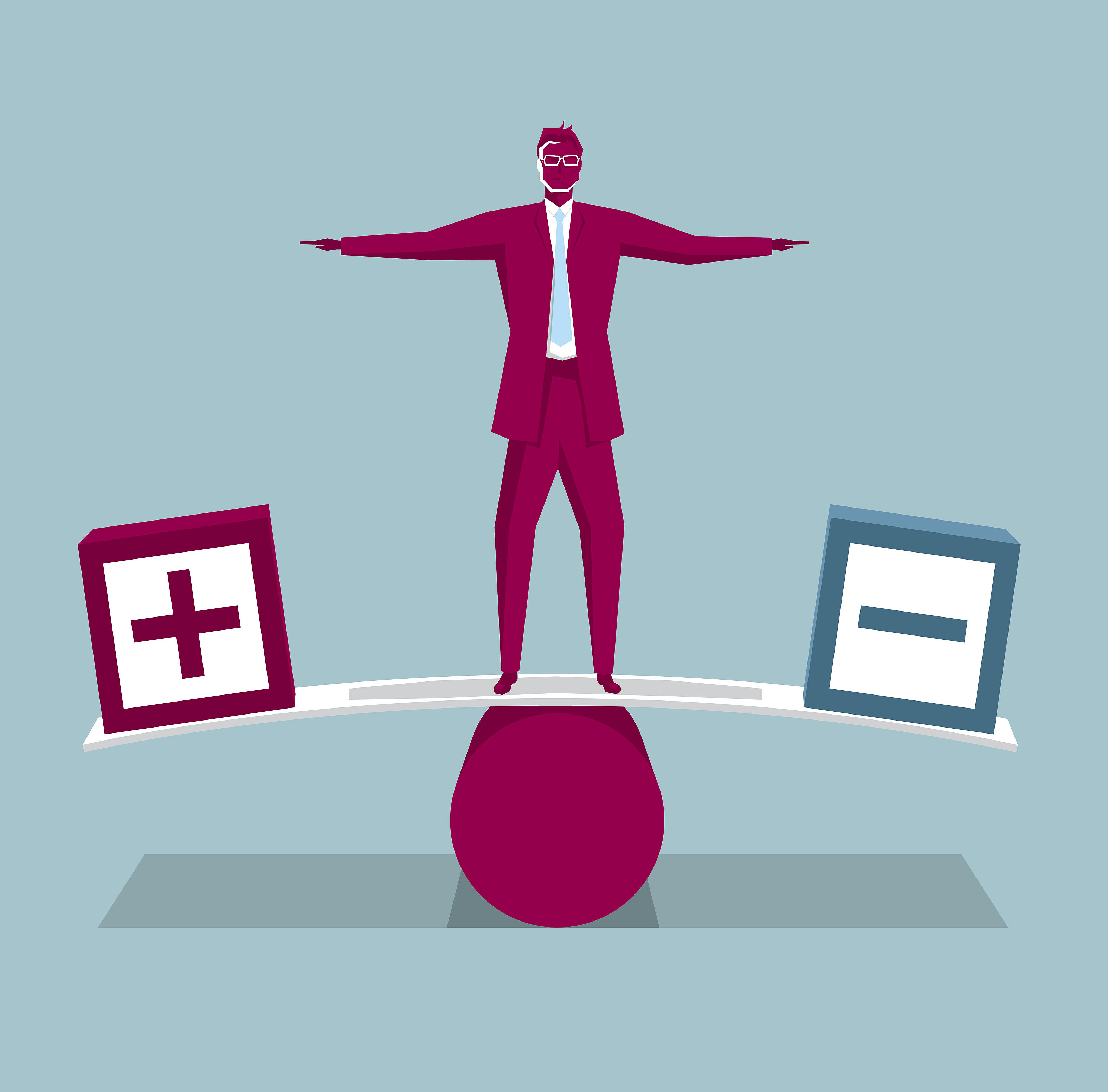Datenschutz im IKS: Worauf es zu achten gilt

Passende Arbeitshilfen
Ausgangssituation des Datenschutz im IKS
Neben der am 25. Mai 2018 in Kraft getretenen DSGVO, die als EU-Verordnung vor allem auf den allgemeinen Datenschutz und die Verarbeitung von Personendaten im privaten und im öffentlichen Sektor fokussiert, ist für Schweizer Unternehmen auch noch die ePrivacy zu nennen. Hierbei handelt es sich um die Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über die Achtung des Privatlebens und den Schutz personenbezogener Daten in der elektronischen Kommunikation. Mit dieser voraussichtlich 2020 in Kraft tretenden Verordnung soll ergänzend zur EU-DSGVO das Ziel erreicht werden, mehr Transparenz und Sicherheit für die Internetnutzer zu schaffen. Die neue Verordnung wird die alte ePrivacy-Richtlinie (Richtlinie 2002/58/EG) ersetzen.
Diese Abbildung zeigt die drei für Schweizer Unternehmen wesentlichen Datenschutznormen im Überblick.
Gesetzliche Grundlagen für den Datenschutz: Unterschiede zwischen der EU-DSGVO und dem Entwurf des neuen Schweizer Datenschutzgesetzes
Die Revision des Schweizer Datenschutzgesetzes ist stark an die EU-DSGVO angelehnt, es gibt jedoch einige wesentliche Unterschiede. Diese hat das Beratungsunternehmen PWC einander gegenübergestellt. Nachfolgend werden die wesentlichsten Unterschiede aus dieser Gegenüberstellung zusammengefasst (PWC, 2018):
Jetzt weiterlesen mit 
- Unlimitierter Zugriff auf über 1100 Arbeitshilfen
- Alle kostenpflichtigen Beiträge auf weka.ch frei
- Täglich aktualisiert
- Wöchentlich neue Beiträge und Arbeitshilfen
- Exklusive Spezialangebote
- Seminargutscheine
- Einladungen für Live-Webinare