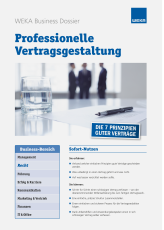Kündigung zur Unzeit: Risikominderung durch den pauschalisierten Schadenersatz
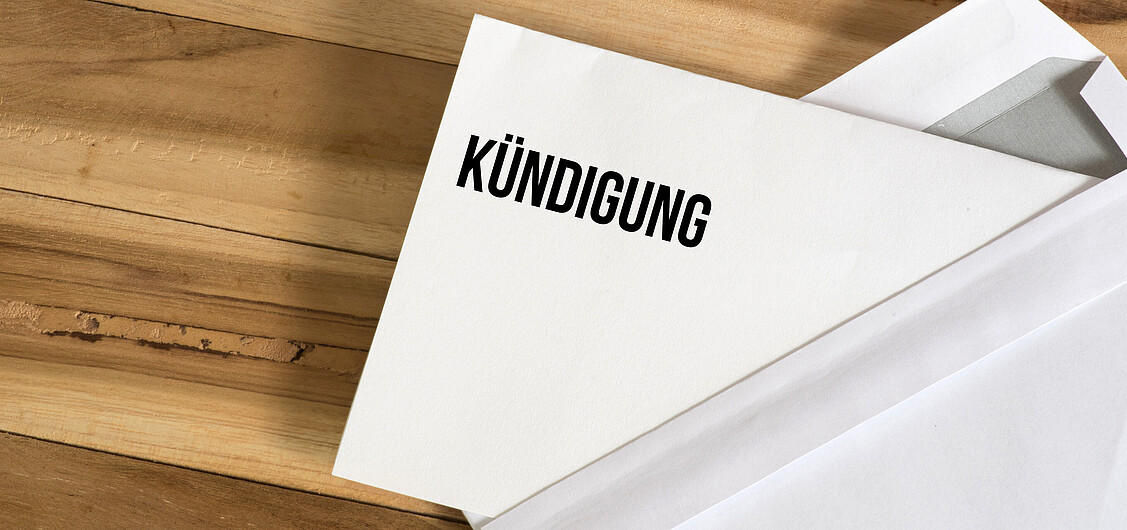
Passende Arbeitshilfen
Abgrenzung des Auftrags- vom Arbeits- und Werkvertrag
Als Recht der meisten Dienstleistungsverträge kommt dem Auftragsrecht grosse Relevanz zu. Beim Auftrag verpflichtet sich der Beauftragte, die ihm übertragenen Geschäfte oder Dienste entgeltlich oder unentgeltlich vertragsgemäss zu besorgen (Art. 394 Abs. 1 OR).
Das Auftragsrecht erfasst alle Vereinbarungen, die nicht einem gesetzlichen Sondertypus unterstellt sind. Letzteres sind beispielsweise der Arbeits- oder Werkvertrag. Vom Arbeitsvertrag unterscheidet sich der Auftrag insofern, als es an der typischen Einordung in eine fremde Betriebsorganisation (Subordinationsverhältnis) fehlt. Auftraggeber und Beauftragter befinden sich nicht in einem Über- und Unterordnungsverhältnis. Vielmehr ist der Beauftragte selbstständig tätig. Dem Werkvertrag immanent ist der geschuldete Erfolg. Demgegenüber wird beim Auftrag ein blosses Tätigwerden verlangt.
Jederzeitiges Kündigungsrecht nach Art. 404 OR
Gemäss Art. 404 Abs. 1 OR kann der Auftrag von jedem Teil jederzeit widerrufen oder gekündigt werden. Inwiefern eine Auftragskündigung einen Schadenersatz nach sich zieht, beurteilt sich nach Art. 404 Abs. 2 OR.
Denn erfolgt die Kündigung zur Unzeit, so ist der zurücktretende Teil zum Ersatz des dem anderen verursachten Schadens verpflichtet (Art. 404 Abs. 2 OR). Folglich kann der Auftrag von den Vertragsparteien einseitig und jederzeit aufgelöst werden. Dazu braucht es keinen objektiven oder gar wichtigen Rechtfertigungsgrund. Es genügt, dass ein sachlich vertretbarer Grund vorliegt. Wird ein Auftrag gekündigt, tritt die Wirkung mit der Kenntnisnahme der Gegenseite ein und wirkt ex nunc (lat. «von nun an»). Der Auftraggeber hat dem Beauftragten die bereits geleistete Arbeit zu vergüten; gegenseitige Ansprüche können verrechnet werden.
Jederzeitiges Kündigungsrecht als zwingendes Recht
Das jederzeitige Kündigungsrecht stellt die Praxis regelmässig vor Herausforderungen. Die Entwicklungen des wirtschaftlichen Verkehrs haben eine Vielzahl an Verträgen hervorgebracht, denen das historisch bedingte, jederzeitige Kündigungsrecht nicht gerecht wird. Dies resultiert in einer erhitzten Diskussion über den zwingenden Charakter dieser Norm.
Dabei hält das Bundesgericht an der zwingenden Natur von Art. 404 Abs. 1 OR fest. Das jederzeitige Kündigungsrecht darf weder abgeändert noch unzulässig erschwert werden. Auch dürfen die Vertragsparteien nicht im Voraus darauf verzichten. Folgerichtig ist eine Konventionalstrafe, die bedingungslos bei einer einseitigen Auftragskündigung wirksam wird, rechtswidrig.
Ebenso wenig lässt sich das Kündigungsrecht durch geschickte Vertragsausgestaltung einfach umgehen. Denn das jederzeitige Beendigungsrecht gilt auch für gemischte Verträge, für welche hinsichtlich der zeitlichen Bindung der Parteien die Bestimmungen des Auftragsrechts als sachgerecht erscheinen. Dabei werden unter gemischten Verträgen Vereinbarungen verstanden, die verschiedene Elemente gesetzlicher Vertragstypen aufweisen und nicht eindeutig einer Vertragsart zugeordnet werden können.
Praxisbeispiel: In der Folge kommt Auftragsrecht inklusive des jederzeitigen Beendigungsrechts beispielsweise beim nicht gesetzlich definierten Unterrichts- bzw. Internatsvertrag zu Anwendung. Dass sich z.B. für private Bildungsinstitutionen hierbei gewichtige Nachteile betreffend Planungssicherheit und Finanzen ergeben können, wenn mitten im Ausbildungssemester Teilnehmer abspringen und per Austritt keine Kursgebühren mehr bezahlen, ist selbsterklärend.
Inwiefern der pauschalisierte Schadenersatz zur Lösung dieser Problematik beitragen kann, wird nachfolgend thematisiert.
Kündigung zur Unzeit
Wie bereits dargestellt, kann das jederzeitige Beendigungsrecht nicht wegbedungen werden. Jedoch sieht Art. 404 Abs. 2 OR Schadenersatz für den Fall vor, dass eine Auftragskündigung zur Unzeit erfolgt. Dabei ist die zurücktretende Partei zum Ersatz des der Gegenpartei verursachten Schadens verpflichtet.
Eine Kündigung zur Unzeit wird angenommen, wenn die beendigungswillige Partei ohne Grund, d.h. in einem ungünstigen Moment ohne sachliche Rechtfertigung, der anderen Partei besondere Nachteile verursacht.
Kündigt der Auftraggeber den Auftrag, so ist die Auftragsbeendigung vermutungsweise unzeitig, wenn der Beauftragte zur Vertragsauflösung keinen begründeten Anlass gegeben hat und er für den Beauftragten hinsichtlich des Zeitpunkts und der von ihm getroffenen Dispositionen nachteilig ist. In Bezug auf den bereits erwähnten Unterrichtsvertrag gilt beispielsweise eine Kündigung durch Kursbesucher unzeitig, wenn sie mitten im Semester erfolgt.
Rechtsfolgen der Kündigung zur Unzeit
Der Widerruf zur Unzeit verpflichtet die vom Vertrag zurücktretende Partei, Schadenersatz zu leisten. Dieser bemisst sich grundsätzlich nach den nutzlos gewordenen Aufwendungen (negatives Vertragsinteresse). Dazu gehören die Kosten des Vertragsabschlusses, infolge Vertragsauflösung unnütz gewordene Dispositionen, etc. Anspruch auf entgangenen Gewinn besteht grundsätzlich nicht, sondern lediglich auf Ausgleich der besonderen Nachteile als Folge des unzeitigen Widerrufs.
Daraus resultiert, dass entgangener Gewinn nur geltend gemacht werden, wenn bewiesen werden kann, dass andere entgeltliche Aufträge abgelehnt worden sind und eine Wettmachung durch neue Aufträge nicht möglich ist. Dies ist schwierig zu beweisen und deshalb mit grosser Unsicherheit verbunden.
Möglichkeit des pauschalisierten Schadenersatzes
Indes kann für den Fall eines Widerrufs zur Unzeit gemäss Art. 404 Abs. 2 OR eine Konventionalstrafe vereinbart werden. Eine solche Abrede, deren Anwendung auf den Widerruf zur Unzeit beschränkt ist, ist zulässig. Sie hat den Vorteil, dass auch in reduziertem Ausmass entgangener Gewinn geltend gemacht werden kann.
Die zulässige Höhe des pauschalisierten Schadenersatzes ist einzelfallabhängig. Dabei ist eine Pauschale, die die Höhe des vollen Honorars erreicht, in der Regel unzulässig. Ein übermässiger Betrag kann vom Gericht in analoger Anwendung von Art. 163 Abs. 3 OR herabgesetzt werden.
Praxisbeispiel: Mit Blick auf den als Beispiel aufgeführten Unterrichtsvertrag wurde eine Vertragsklausel als wirksame Konventionalstrafe und somit zulässig erachtet, die vorsah, dass Kursteilnehmer den Anspruch auf Rückerstattung der Kursgebühren bei Vertragsauflösung zur Unzeit verlieren. Dies jedoch unter der Prämisse, dass die Vertragsbeendigung nicht durch sachliche Gründe, wie z.B. mangelhafte Unterrichtsqualität, gerechtfertigt ist.
Die Verankerung einer Konventionalstrafe für den Fall der Kündigung zur Unzeit kann somit für Dienstleistungserbringer ein geeignetes Mittel zur finanziellen Absicherung darstellen. Das Risiko, wegen kurzfristigen Vertragsauflösungen auf bereits getätigten Ausgaben sitzen zu bleiben, kann dadurch minimiert werden.
Fazit
Das jederzeitige Kündigungsrecht im Auftragsverhältnis birgt vor allem aufseiten der Auftragnehmer wegen der dauernden Ausfallgefahr von Aufträgen finanzielle Risiken. Dieses Kündigungsrecht kann auch in gegenseitigem Einvernehmen nicht wegbedungen werden. Tritt der Auftragsgeber vom Vertrag zurück, sind lediglich die bisherigen Aufwendungen des Beauftragten zu vergüten. Einzig bei der Kündigung zur Unzeit kann eine Entschädigung geschuldet sein, wobei diese nur für bereits getätigte, nutzlos gewordene Dispositionen zu leisten ist.
Durch vertragliche Verankerung einer Schadenspauschale bei der Kündigung zur Unzeit kann sich der Auftragnehmer jedoch absichern. Insbesondere wird die Chance erhöht, für die eigenen finanziellen Ausfälle vergütet zu werden. Zudem wirkt sie abschreckend im Sinne, dass dem Auftraggeber die finanziellen Risiken einer Kündigung zur Unzeit vor Augen geführt werden.