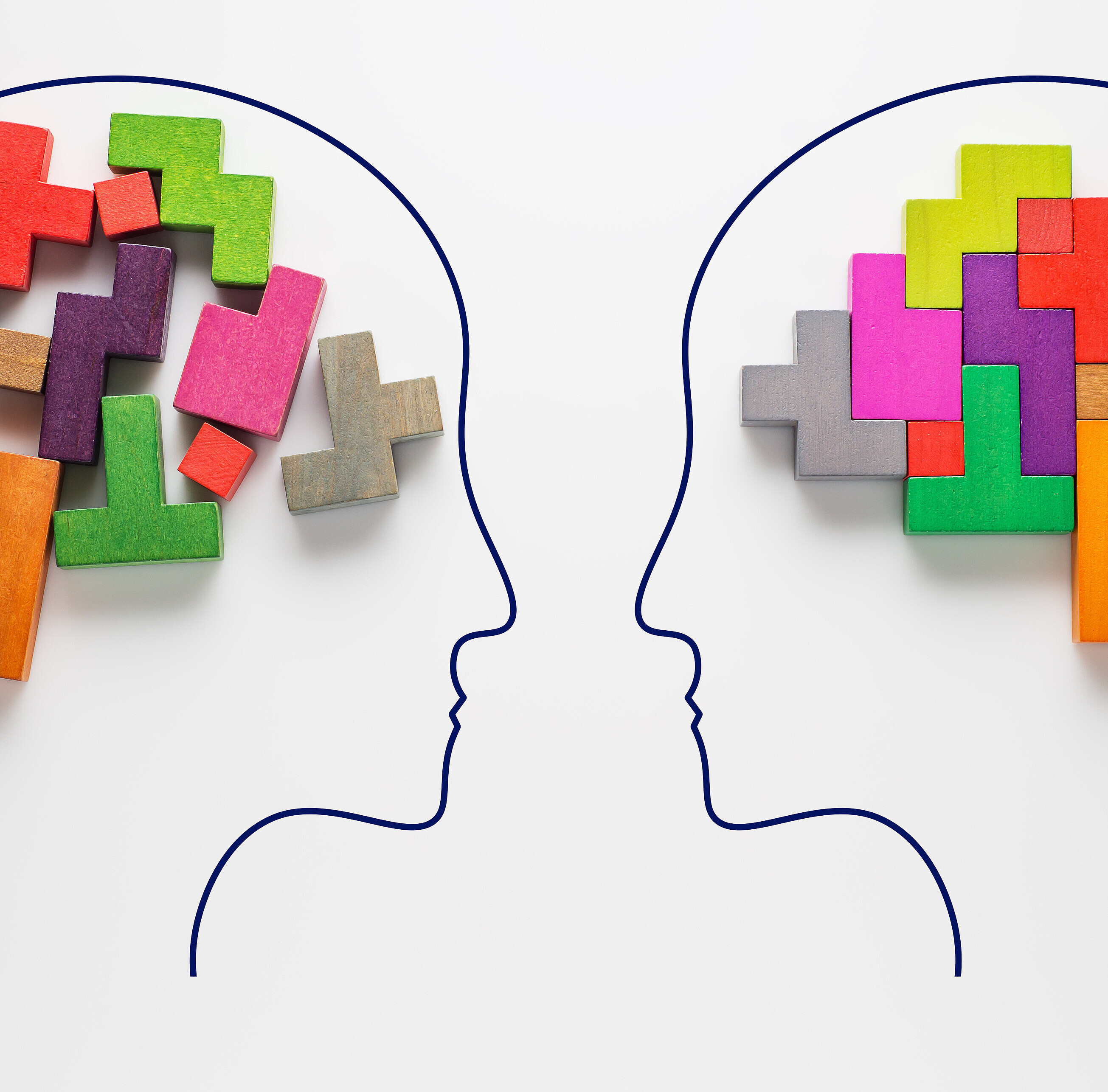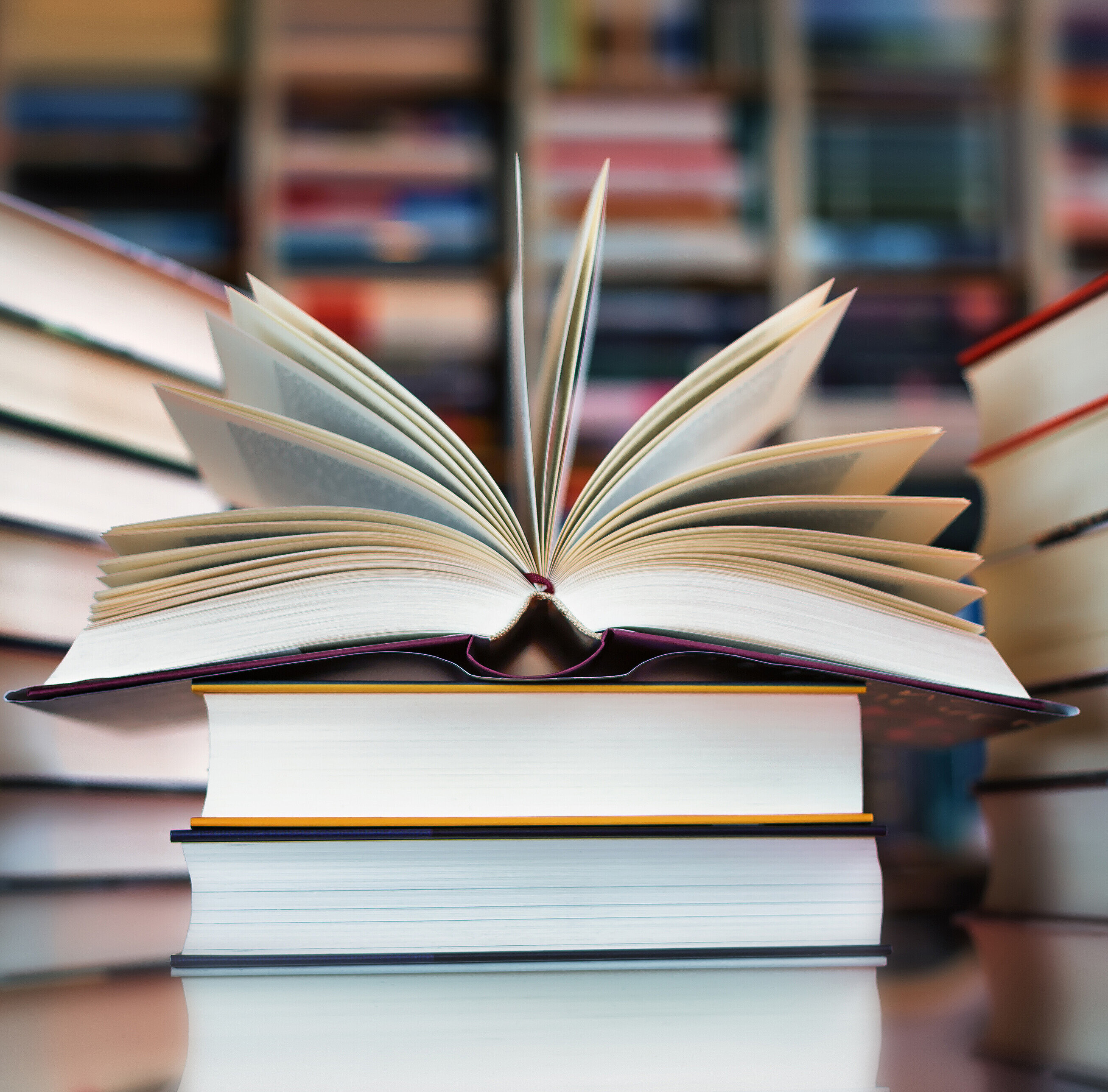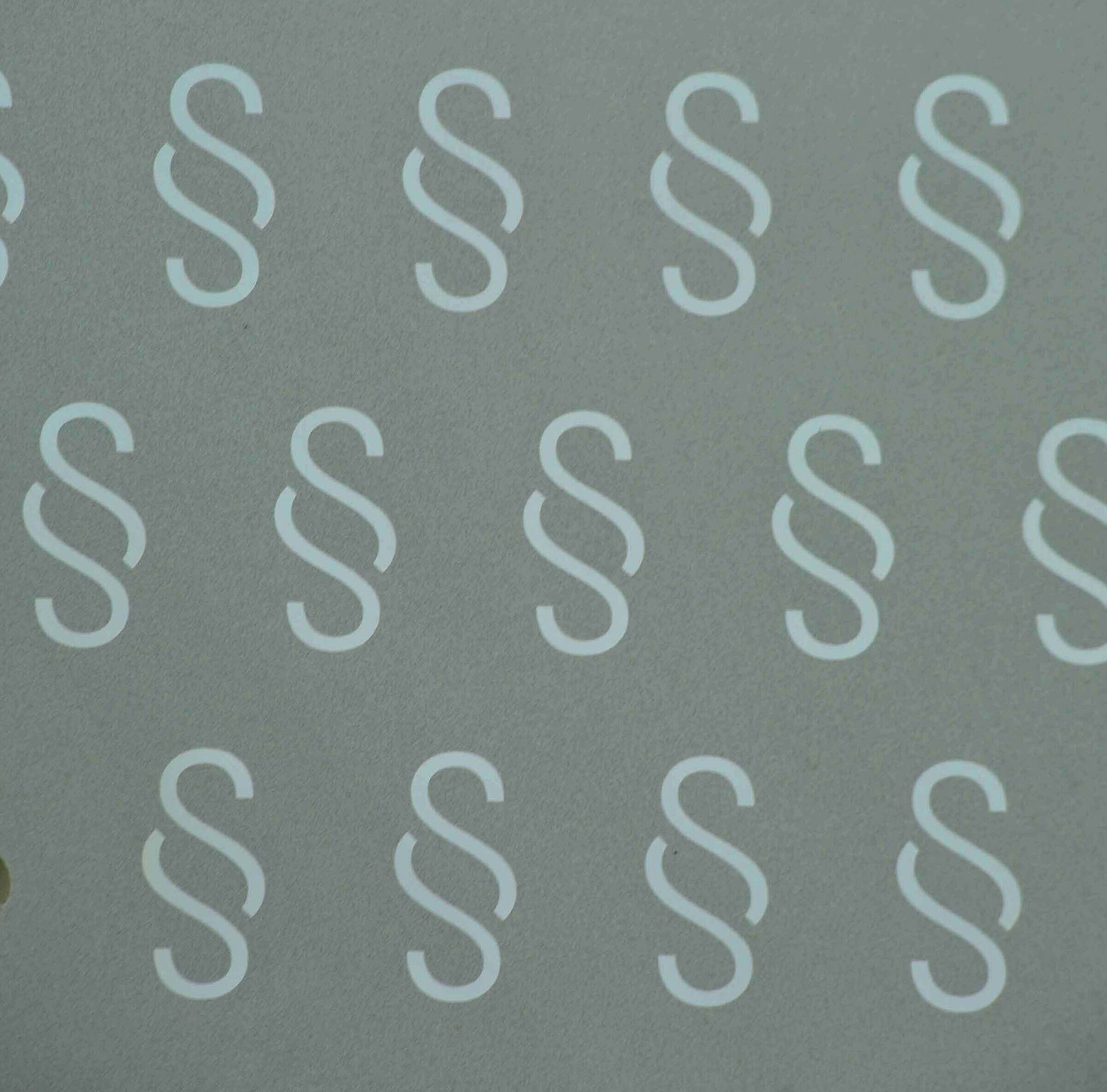Vertragsfreiheit: Verletzung der inhaltlichen Schranken und Gültigkeit der Vertragsstörung
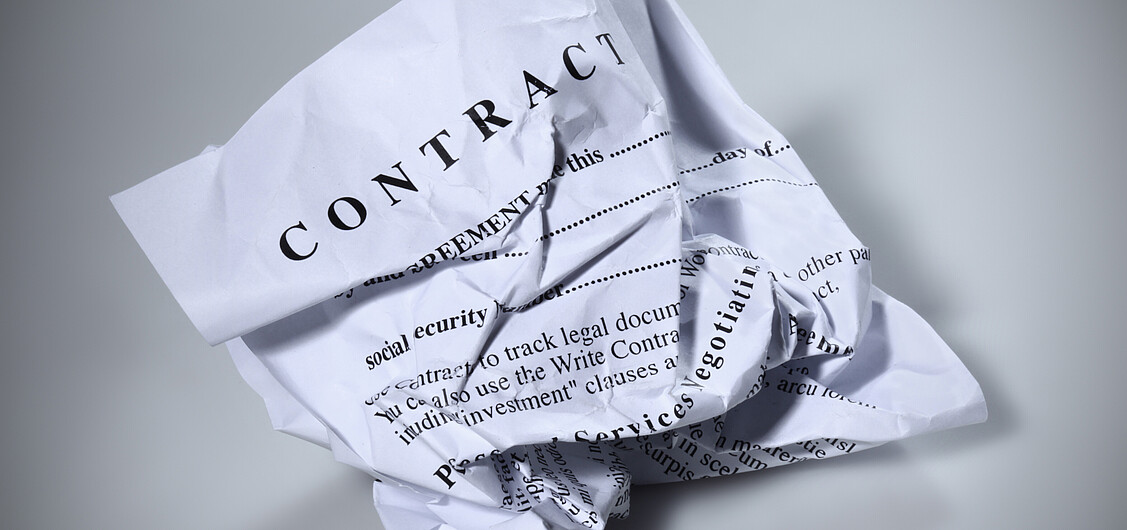
Passende Arbeitshilfen
Das Obligationenrecht geht vom Grundprinzip aus, dass der Inhalt des Vertrages innerhalb der Schranken des Gesetzes von den Parteien beliebig festgesetzt werden kann. Diese Grundregel wird insofern eingeschränkt, als ein Vertrag nichtig ist, wenn er einen unmöglichen oder widerrechtlichen Inhalt hat oder gegen die guten Sitten verstösst. Eine weitere Schranke der Vertragsfreiheit ergibt sich aus Art. 27 ZGB, wonach sich niemand seiner Freiheit entäussern oder sich in ihrem Gebrauch in einem das Recht oder die Sittlichkeit verletzenden Grade beschränken kann.
Während man in vergangenen Jahrhunderten jeweils eine inhaltliche Kontrolle der Vertragsrichtigkeit vorsah, sind heute der Privatautonomie vorwiegend durch die erwähnten Schranken die Grenzen gezogen worden.
Während Art. 20 OR den Schutz vor rechtswidrigen und sittenwidrigen Verträgen vorsieht, geht der Persönlichkeitsschutz nach Art. 27 ZGB davon aus, dass eine vertragliche Bindung nicht rechtlichen Bestand haben darf, wenn ein Bereich, der bindungsfrei bleiben soll, betroffen ist. Dabei sind zwei Fälle zu unterscheiden: Entweder betrifft der Vertrag einen Bereich, in dem jegliche Entäusserung der Freiheit unzulässig ist, oder die vertragliche Freiheitsbeschränkung erreicht ein Ausmass, welches einen ‹das Recht oder die Sittlichkeit verletzenden Grad› erreicht.
Im Folgenden wird zunächst auf das Prinzip der Vertragsfreiheit eingegangen, um dann in einem weiteren Schritt die inhaltlichen Schranken nach Art. 20 OR festzulegen. Abschliessend soll der Persönlichkeitsschutz nach Art. 27 ZGB diskutiert werden.
Vertragsfreiheit und zwingendes Recht
Das Prinzip der Vertragsfreiheit, das unter anderem die inhaltliche freie Gestaltung der Verträge und die Freiheit der Partnerwahl vorsieht, wird zunächst eingeschränkt durch sog. zwingende Gesetzesvorschriften. Diese zwingenden Gesetzesvorschriften stellen eine Ausnahme vom Grundsatz dar, wonach die Vertragsparteien bei der Wahl des Vertragsinhaltes frei sind. Zwingende Gesetzesvorschriften gibt es vorab im Bereich des Besonderen Teils des Obligationenrechts. Namentlich sollen hier die zwingenden abzahlungs-, miet- und bürgschaftsrechtlichen Vorschriften erwähnt werden.
Ob eine Vorschrift zwingenden Charakter hat, wird im Gesetz nicht immer ausdrücklich geregelt. Der zwingende Charakter kann sich auch durch einen festen Sprachgebrauch andeuten oder aus der Sachlogik heraus gefolgert werden.
Weiter ist darauf hinzuweisen, dass es Normen gibt, die aufgrund der Interessenlage bloss einseitig zwingend sind. Das bedeutet, dass der Vertrag zugunsten der einen (nicht jedoch der anderen) Partei von der gesetzlichen Regelung abweichen kann.
Unmöglichkeit des Vertragsinhaltes
Ein Vertrag mit einem unmöglichen Inhalt ist nach Art. 20 OR nichtig.
Der rechtspolitische Sinn der Regelung liegt darin, dass die Rechtsordnung vernünftigerweise niemandem etwas abverlangen kann, wozu dieser objektiv unmöglich in der Lage ist.
Als Voraussetzung gilt, dass die versprochene Leistung aus objektiven Gründen, also auch durch jeden anderen als den Schuldner, nicht erbringbar ist.
Praxis-Beispiel
Nichtig ist etwa die absurde, aber versprochene Leistung, dass Herr Meier den Königsthron von Böhmen erhalten wird. Faktische Unmöglichkeit der Leistungserbringung liegt auch vor, wenn die Leistung als solche (physisch) unmöglich erbracht werden kann. Namentlich erwähnt sei hier das Beispiel, dass A dem B ein Bild am 2. Januar verkauft, dieses aber schon am 1. Januar (ohne das Wissen beider Parteien) zerstört, physisch vernichtet worden ist.
Jetzt weiterlesen mit 
- Unlimitierter Zugriff auf über 1100 Arbeitshilfen
- Alle kostenpflichtigen Beiträge auf weka.ch frei
- Täglich aktualisiert
- Wöchentlich neue Beiträge und Arbeitshilfen
- Exklusive Spezialangebote
- Seminargutscheine
- Einladungen für Live-Webinare