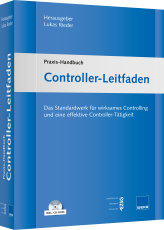Lean Controlling: Erhöhung der Effektivität und Effizienz

Passende Arbeitshilfen
Beurteilung der Controlling-Effizienz
Im Rahmen des Lean Controlling geht es bei der Beurteilung der Controlling-Effizienz grundsätzlich um das Verhältnis zwischen dem Leistungs-Output des Controllings und den damit verbundenen objektiven Aufwand hinsichtlich Zeit und Kosten. Effizienz im Sinne, etwas «richtig zu tun», lässt sich wie beim Financial Accounting relativ problemlos über Kennzahlen messen. Wie man bei der Finanzbuchhaltung beispielsweise die Kosten des Jahresabschlusses in Relation zum Umsatz (cost-revenue ratio) respektive zum EBIT (cost-income ratio) oder die Kosten für eine Buchung berechnen kann, lassen sich auch zur Messung der Controlling-Effizienz entsprechende Lean Controlling Performance Kennzahlen berechnen.
So zum Beispiel die Kosten des internen Reportings im Verhältnis zum Umsatz, die Dauer des Budgetierungsprozesses oder ähnliches. Benchmarking-Analysen sind jedoch diesbezüglich mit grosser Vorsicht vorzunehmen, da die Ausgestaltung und der Umfang eines Management Accounting wesentlich unternehmensspezifischer sind als dies beim Financial Accounting der Fall ist.
Beurteilung der Controlling-Effektivität
Die Beurteilung der Controlling-Effektivität ist ungleich schwieriger vorzunehmen, da es hier darum geht, die Wirksamkeit des Controlling («das Richtige tun») anhand des wahrgenommenen Nutzens zu messen, welcher hochgradig subjektiv ist und daher schon ex definitione unterschiedlich beurteilt wird. Während ein und der gleiche Report von Empfänger A als sehr informativ und wertvoll wahrgenommen wird, kann ihn Empfänger B im Extremfall als überflüssig und wertlos empfinden, wohingegen Empfänger C gar nicht von seiner Existenz Kenntnis hat.
Da es beim Controlling im Gegensatz zur Finanzbuchhaltung keine gesetzliche Verpflichtungen und Reglementierungen gibt, sind hier die für das Controlling Verantwortlichen gefordert, auf den entgangenen Nutzen hinzuweisen, die dem Informations-Empfänger bei Nicht-Beachtung der Information entsteht. Gelingt dies nicht überzeugend, so ist auf die Wahrnehmung der Informationsempfänger abzustellen und der Report als ineffektiv einzustufen.
Lean Controlling als Optimierung der Controlling-Effizienz
In einem ersten Schritt sollte für jeden Report der jeweilige Informationserstellungs- und -verteilungsprozess aufgenommen und visualisiert werden. So können Problembereiche wie z.B. Ressourcenengpässe oder IT-Inkompatibilitäten identifiziert und im Idealfall beseitigt oder zumindest überdacht werden. In vielen Fällen kann durch den Einsatz von entsprechenden IT-Systemlösungen der Zeitbedarf für Routinetätigkeiten durch Prozess-Standardisierung und –Automatisierung erheblich reduziert werden. Ziel aller Massnahmen des Lean Controlling ist es, durch eine schlankere Prozessgestaltung die Prozessdurchlaufzeit und damit den Controlling-Aufwand deutlich zu reduzieren.
Eng mit der Prozessoptimierung verbunden ist die Überlegung, ab einer bestimmten Unternehmensgrösse, Standard-Controlling Prozesse an Shared Service Organisationseinheiten auszulagern, um über optimierte Personalkostenstrukturen die Gesamtkosten des Controlling deutlich abzusenken.
Die Optimierung von Dienstleistungsprozessen und organisatorische Auslagerung von Standardtätigkeiten entlasten den Stammhaus-Controller von seinen wenig wertschöpfenden Routinetätigkeiten (wie bspw. die Aufbereitung, Korrektur und Distribution von Informationen), so dass die frei gewordenen Zeitkapazitäten es ermöglichen, sich auf Tätigkeiten mit höherer Wertschöpfung (wie bspw. die Analyse und Kommentierung von Planabweichungen) zu konzentrieren.
Technologische Möglichkeiten zur Effizienzsteigerung des Controllings
Auch wenn die Digitalisierung momentan von vielen Unternehmen euphorisch per se mit „Effizienzsteigerung“ gleichgesetzt wird, muss dazu jedoch kritisch angemerkt werden, dass eine blosse Digitalisierung nicht zwingend eine Prozesseffizienz hervorruft. Im Zweifel ist das Ergebnis ein ineffizienter digitaler Reportingprozess. Jedoch haben die technologische Fortschritte im IT-Bereich durchaus das Potenzial, die Effizienz des Controllings exponentiell zu steigern. Durch cloudbasierte Lösungen können Datenkapazitäten massiv erhöht und Datenflüsse stark optimiert werden. Dies ermöglicht eine mehrheitlich automatisierte Datenaufbereitung in der gewünschten Frequenz (bis hin zu einem Echtzeit-Reporting) und ermöglicht dem Controller, mehr Zeit für Aufgaben mit höherem Wertschöpfungsgrad, wie z.B. der Datenanalyse und -interpretation. Datenvisualisierungstools erlauben eine ansprechende und fokussierte Darstellung der Kennzahlen sowie eine intuitive Navigierung zum gewünschten Detaillierungsgrad. Sie sind relativ kostengünstig in der Anschaffung und mit vergleichbar wenig Aufwand in die bestehende IT Landschaft integrierbar. Zudem sind die Zugriffsmöglichkeiten vielfältig und auf die Bedürfnisse der Empfänger anpassbar – von statischen wiederkehrenden Reports zu flexiblen Self-Service Reporting-Möglichkeiten, ob klassisch auf dem PC ersichtlich oder mobil auf Tablets und Smartphones aufrufbar. Will man über diese bereits etablierten digitalen Möglichkeiten hinausgehen, erlauben Artifical Intelligence Technologien (cognitive computing) eine beinahe ausschließlich automatisierte Berichterstattung und Entscheidungsunterstützung wie automatisch generierte Kommentierung (durch NLG – Natural Language Generation), Siri-ähnliche Funktionalitäten (durch NLP – Natural Language Processing) sowie intelligente Entscheidungsvorschläge, welche durch machine learing immer präziser und umfänglicher werden, je länger man diese Technologie im Einsatz hat.
Lean Controlling als Optimierung der Controlling-Effektivität
Die Erhöhung der Controlling-Effektivität verfolgt das Ziel, dass die Informationsempfänger das Reporting als nützlicher empfinden und darauf basierend bessere Entscheidungen treffen können. Zum einen sollte versucht werden, das Berichtswesen von unnötigem Datenballast zu befreien. Dazu sollte man die Sinnhaftigkeit aller Reports einer kritischen Überprüfung unterziehen. Ein Informationsangebot ohne Nachfrage ist als nicht wertschöpfende Überproduktion zu werten und einzustellen. Zum anderen geht es darum, zu überprüfen, ob bislang nicht erhobene Daten berücksichtigt werden sollten, wenn diese für die Empfängerseite wichtig sind.
Die optimale Grösse eines Berichtswesen ist nicht etwa dann erreicht, wenn es keinen weitere Kennzahl mehr hinzuzufügen gäbe, sondern vielmehr dann, wenn keine Kennzahl mehr weggelassen werden könnte, ohne dass dadurch der Informationsnutzen für den Empfänger geschmälert würde.