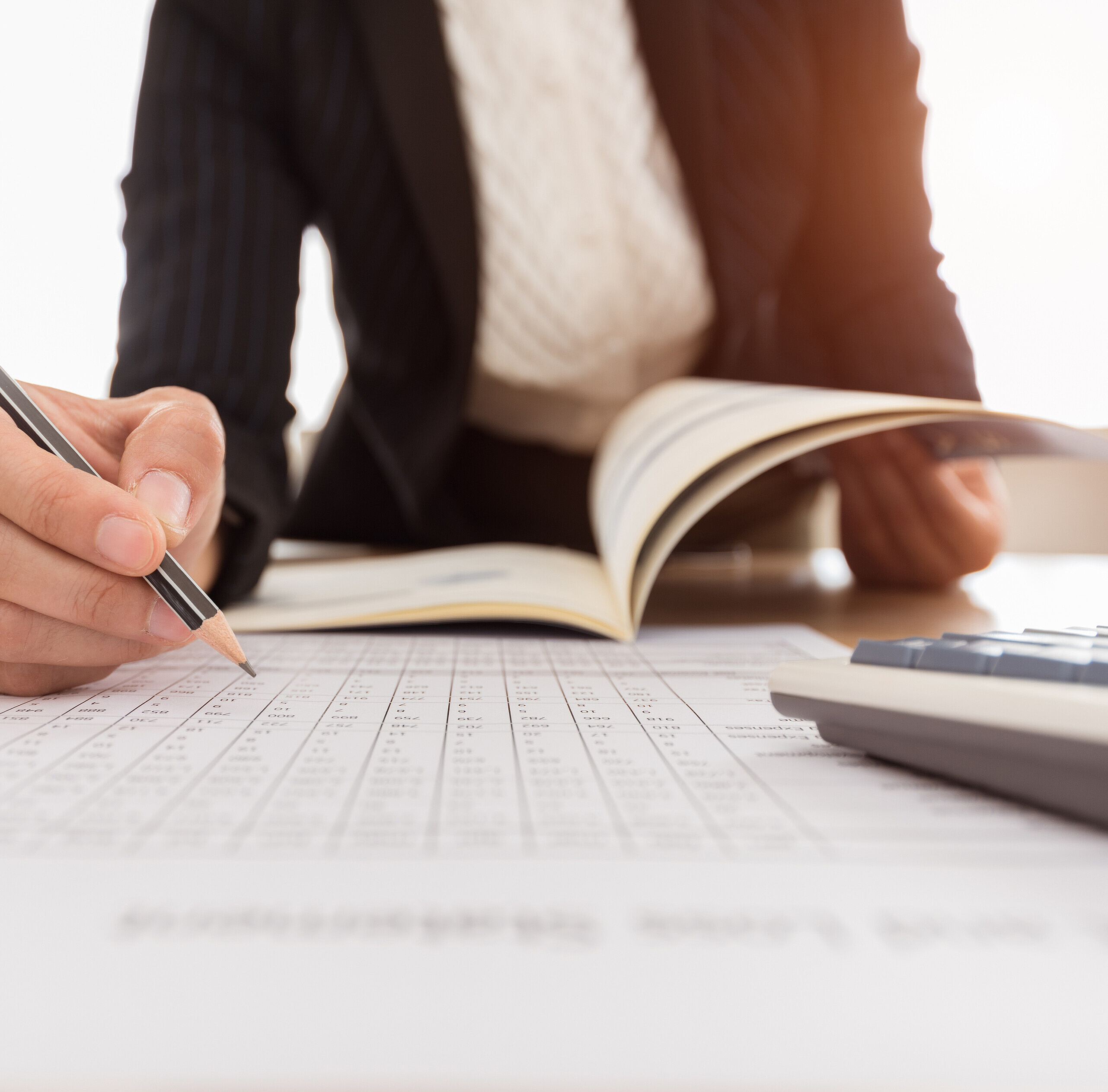Teilzeitarbeit: Besonderheiten und Fallstricke

Passende Arbeitshilfen
Flexible Arbeitsmodelle
Heutzutage sind zunehmend flexible Teilzeitarbeitsmodelle als Alternative zur klassischen Vollzeitbeschäftigung gefragt. Dabei profitieren Arbeitgebende nicht zuletzt von der flexiblen Einsatzplanung, die sie abhängig von der Auftragslast vornehmen können, geringeren Fehlzeiten sowie der erhöhten Zufriedenheit der Mitarbeitenden, die sich positiv auf ihre Produktivität auswirkt. Demgegenüber sehen sich Arbeitgebende oft mit einem erhöhtem Administrations- und Koordinationsaufwand konfrontiert.
Auch bei Stellensuchenden gewinnen Teilzeitmodelle an Beliebtheit, indem sie ihre Arbeitszeit flexibel an ihre individuellen Bedürfnisse anpassen können. Zu nennen sind insbesondere familiäre Gründe (z.B. Kinderbetreuung), gesundheitliche Gründe, persönliche Gründe (z.B. Work-Life-Balance), Aus- und Weiterbildungen sowie das Alter (z.B. gestaffelte Pensionierung).
Unter Teilzeitarbeit werden sämtliche Anstellungsverhältnisse gefasst, bei denen das Arbeitspensum reduziert ist. Auf dem Arbeitsmarkt finden sich unterschiedliche Erscheinungsformen der Teilzeitarbeit:
- klassische Teilzeitarbeit (z.B. 60%-Arbeitspensum)
- Arbeit im Stundenlohn (z.B. 20 Stunden pro Woche)
- Arbeit auf Abruf (unregelmässige Arbeitseinsätze, abhängig vom zu bewältigenden Arbeitsvolumen)
- Jobsharing (Vollzeitarbeitsstelle wird von zwei oder mehreren Mitarbeitenden in Teilzeitarbeit ausgeübt, z.B. wird der IT-Support unter der Woche drei Tage durch Mitarbeiter A und die übrigen Tage durch Mitarbeiter B besetzt) Wichtig zu wissen ist, dass Teilzeitarbeitsverhältnisse den gleichen gesetzlichen Bestimmungen wie Vollzeitarbeitsverhältnisse unterliegen, u.a. dem Arbeitsgesetz sowie den allfällig einschlägigen Gesamt- und Normalarbeitsverträgen.
Ferienanspruch
Trotz der reduzierten Arbeitszeit sind auch den Mitarbeitenden im Teilzeitarbeitsverhältnis Ferien zu gewähren (Art. 329a Abs. 1 OR). Diese sind im Umfang von vier bzw. fünf Kalenderwochen zuzusprechen und können nicht aufgrund geringerer Arbeitseinsätze verkürzt werden. Ebenfalls geschuldet ist der Ferienlohn, dessen Höhe sich nach dem durchschnittlichen Teilzeiterwerbseinkommen bemisst. Im Allgemeinen ist die Abgeltung des Ferienanspruchs durch Geldleistungen unzulässig (Art. 329d Abs. 2 OR). Eine Ausnahme besteht bei unregelmässigen oder sehr kurzen Arbeitseinsätzen (z.B. Arbeit auf Abruf), wo sich die Berechnung des Ferienlohns meist als schwierig erweist, sofern die Ferienzuschläge gesondert im Lohnausweis ausgewiesen werden.
Versicherungsobligatorium?
Auch wenn Mitarbeitende in flexiblen Arbeitsmodellen beschäftigt werden, können den Arbeitgebenden sozialversicherungsrechtliche Pflichten treffen:
- Beträgt die wöchentliche Arbeitszeit mindestens acht Stunden, muss der Mitarbeitende obligatorisch für Berufs- und Nichtberufsunfälle versichert werden (Art. 2 UVG und Art. 13 UVV).
- Zusätzlich sind die Mitarbeitenden auch in der beruflichen Vorsorge obligatorisch zu versichern, sofern die Entlöhnung für das Teilzeitarbeitsverhältnis einem Jahreslohn von aktuell mindestens CHF 22 050.– entspricht (Art. 3a BVV 2).
Überstundenarbeit
Auch Teilzeitmitarbeitende können zur Leistung von Überstunden verpflichtet werden, sofern sie diese zu leisten vermögen und sie ihnen auch zugemutet werden können (Art. 321c Abs. 1 OR). Wenn diese allfälligen Überstunden nicht durch Freizeit ausgeglichen werden können und auch vertraglich nichts anderes vereinbart wurde, sind die geleisteten Überstunden mit einem Zuschlag von 25% zu entschädigen (Art. 321c Abs. 3 OR).
Lohnfortzahlungsanspruch
Bei mindestens dreimonatigen Arbeitsverhältnissen haben alle Teilzeitmitarbeitenden in unverschuldeten Verhinderungsfällen wie Krankheit oder Unfällen einen Lohnfortzahlungsanspruch (Art. 324a Abs. 1 OR). Wurde keine Krankentaggeldversicherung abgeschlossen, und enthält der Arbeitsvertrag auch keine entsprechende Regelung, so ist die Lohnfortzahlung bloss während einer beschränkten Zeitdauer geschuldet, z.B. im ersten Dienstjahr für drei Wochen (siehe kantonale Lohnfortzahlungsskala). Kann nicht auf einen Monatslohn abgestellt werden, bemisst sich die Höhe bezüglich schwankender Teilzeiterwerbseinkommen entweder nach dem durchschnittlichen Einkommen des letzten Jahres oder einer anderen angemessenen Methode.
Nebenerwerbstätigkeit
Mitarbeitende wollen sich mit einem Nebenjob regelmässig etwas dazuverdienen, oder aber sie versuchen dadurch schrittweise den Weg in die Selbstständigkeit. Unter die Nebenerwerbstätigkeit werden sämtliche Beschäftigungen gefasst, die in Ergänzung zu einer hauptberuflichen Voll- oder Teilzeitarbeit ausgeübt werden. Im Rahmen des Arbeitsverhältnisses trifft die Mitarbeitenden nicht nur eine Arbeits-, sondern auch eine Treuepflicht (Art. 321a OR). Der Ausübung einer Nebenerwerbstätigkeit sind deshalb gewisse Grenzen gesetzt:
- Die maximale wöchentliche Höchstarbeitszeit von 50 Stunden (bei industriellen Betrieben 45 Stunden) darf nicht überschritten werden (Art. 9 ArG und Art. 2 ArGV 1).
- Die tägliche Ruhezeit von mindestens elf aufeinanderfolgenden Stunden muss gewährleistet sein (Art. 15a ArG und Art. 19 ArGV 1).
- Die Arbeitsleistung im Rahmen der Haupterwerbstätigkeit darf durch die Nebenerwerbstätigkeit nicht leiden.
- Damit der Erholungszweck nicht vereitelt wird, dürfen Ferien nicht zu Nebenerwerbstätigkeiten genutzt werden, und
- Konkurrenzverbote dürfen nicht verletzt werden.
Konkurrenzverbot
Mitarbeitende dürfen keiner konkurrenzierenden Tätigkeit nachgehen. Ein Verstoss liegt typischerweise dann vor, wenn jemand entweder bei einer Konkurrenzfirma angestellt ist oder einer selbstständigen Erwerbstätigkeit nachgeht, mit der dem gleichen Kundenkreis gleichartige Leistungen erbracht werden.
Das aus der Treuepflicht fliessende Konkurrenzverbot gilt grundsätzlich nur während der Dauer des Arbeitsverhältnisses. Wenn Arbeitgebende konkurrenzierende Tätigkeiten auch nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses verbieten möchten, bedarf dies einer schriftlichen Vereinbarung im Arbeitsvertrag (Art. 340 ff. OR).
Treuepflichtverletzung
Im Falle von Zuwiderhandlungen gegen die Treuepflicht kann der Arbeitgebende abhängig vom Schweregrad eine Mahnung aussprechen, eine Sanktion im Wiederholungsfall androhen oder eine Kündigung aussprechen. Hat die Pflichtverletzung zudem zu einem Schaden geführt, so kann der Mitarbeitende ausserdem zu Entschädigungsleistungen verpflichtet werden. Um Konflikte zu vermeiden, haben Arbeitgebende ein Interesse daran, die Mitarbeitenden über den Umfang ihrer Treuepflicht in Kenntnis zu setzen sowie vertraglich festzuhalten und deren Einhaltung allenfalls durch Konventionalstrafen abzusichern.