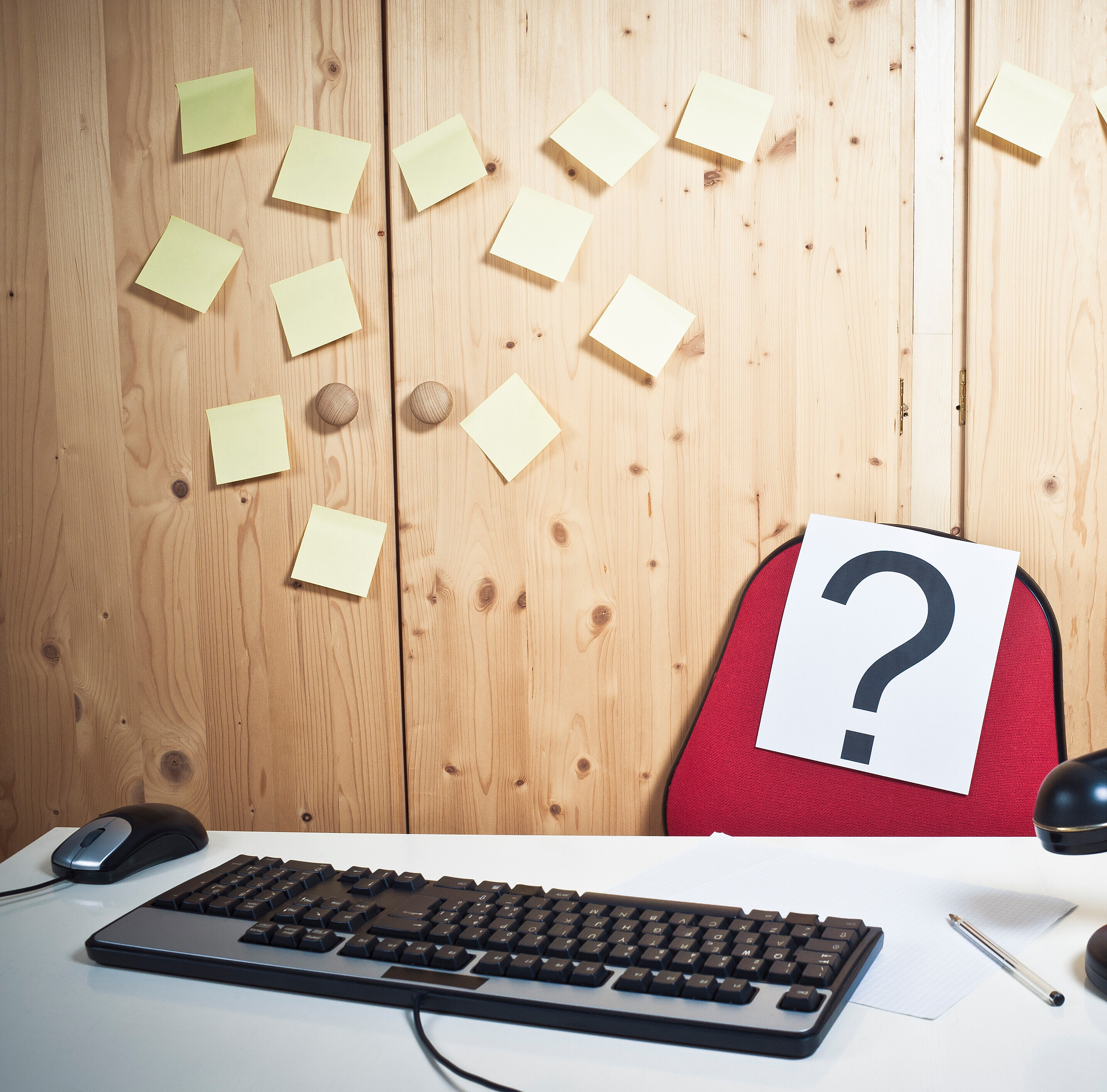Ständige Erreichbarkeit: Keine ruhige Minute mehr

Passende Arbeitshilfen
State of the Art
Fast alle Arbeitgeber statten ihre Mitarbeitenden heute mit elektronischen Geräten aus. Was mit dem Pager begann, führte übers Handy und den Blackberry bis hin zum Smartphone mit Powerbank. In manchen Branchen und Funktionen gehören Laptops mit UMTS-Anschluss längst zum Standard. Mit dem Einsatz mobiler Geräte geht die Erwartung einher, dass die Mitarbeitenden über die vereinbarte Arbeitszeit hinaus oder gar ständig via Telefon, E-Mail oder SMS erreichbar und für Arbeitsleistungen abrufbar sind.
Belastung wirft Fragen auf
Es ist liegt auf der Hand, dass diese neue Form von Arbeitsbeanspruchung in verschiedener Hinsicht zur Belastung für die Mitarbeitenden werden kann. Beispielsweise kann eine durch die ständige Erreichbarkeit ausgelöste Grundanspannung des Arbeitnehmers zu Stresssituationen und gesundheitlichen Beeinträchtigungen führen, zumindest aber wird das Abschalten schwieriger. Ebenso kann das Privat- und Familienleben leiden, wenn ein Mitarbeiter am Feierabend oder in den Ferien ständig damit rechnen muss, mit geschäftlichen E-Mails oder Anrufen konfrontiert zu werden.
In arbeitsrechtlicher Hinsicht stellen sich vor allem Fragen des Persönlichkeitsschutzes, des Datenschutzes, der Arbeits- und Ruhezeit sowie weiterer arbeitsgesetzlicher Normen, der Entlöhnung, des Auslagenersatzes, des Ferienrechts und der einseitigen Einführung durch den Arbeitgeber. Die schweizerische Arbeitsrechtswissenschaft hat sich damit noch kaum befasst und die Rechtsprechung dazu ist ebenfalls so gut wie nicht vorhanden. Dennoch soll versucht werden, einigen der skizzierten arbeitsrechtlichen «Hotspots» im Folgenden etwas schärfere Konturen zu verleihen.
Schlüsselfrage der Arbeitszeit
Die Beantwortung zahlreicher arbeitsrechtlicher Folgefragen hängt von der Schlüsselfrage ab, ob – und wenn ja, inwieweit – eine ständige Verfügbarkeit des Arbeitnehmers als Arbeitszeit einzustufen ist. Mit dem Begriff der Arbeitszeit hat sich der Gesetzgeber primär in Art. 13 Abs. 1 der Verordnung 1 zum Arbeitsgesetz (ArGV 1) beschäftigt, wonach als Arbeitszeit diejenige Zeit gilt, «während der sich der Arbeitnehmer oder die Arbeitnehmerin zur Verfügung des Arbeitgebers zu halten hat». Diese Formulierung ist über die direkte Weisungsunterwerfung hinaus in einem umfassenderen Sinn zu verstehen: Jede Zeitspanne, die der Arbeitnehmer mit Willen des Arbeitgebers in dessen hauptsächlichem Interesse verbringt, ist Arbeitszeit, denn er hält sich und seine Zeit während dieser Zeitspanne zu dessen wirtschaftlicher Verfügung. Folglich ist auch Zeit, die der Arbeitnehmer z.B. zu Hause mit Willen und im hauptsächlichen Interesse des Arbeitgebers, aber ausserhalb von dessen unmittelbarer Weisungsgewalt verbringt, Arbeitszeit.
Bereits Art. 13 ArGV 1 drückt aus, dass die Arbeitszeit keine örtlich oder durch die eingesetzten Betriebsmittel bestimmte Grösse ist und nicht als im Betrieb oder unter Verwendung von Betriebsmitteln des Arbeitgebers verbrachte Zeit zu definieren wäre. Die Leistung von Arbeitszeit setzt auch kein tätig sein voraus, hält sich der Arbeitnehmer doch auch mit einem Bereitschaftsdienst oder durch ganz oder primär untätige Präsenz im Betrieb (z.B. eine Nachtwache in einem Spital) zur Verfügung des Arbeitgebers.
Jetzt weiterlesen mit 
- Unlimitierter Zugriff auf über 1100 Arbeitshilfen
- Alle kostenpflichtigen Beiträge auf weka.ch frei
- Täglich aktualisiert
- Wöchentlich neue Beiträge und Arbeitshilfen
- Exklusive Spezialangebote
- Seminargutscheine
- Einladungen für Live-Webinare