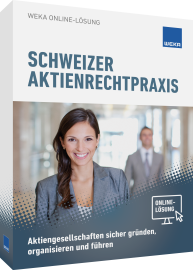Neues Aktienrecht: Die Zukunft ist nachhaltiger und digital

Passende Arbeitshilfen
Aktienrechtsrevision: zeitlicher Horizont
Mit der Verabschiedung der parlamentarischen Aktienrechtsrevision am 19. Juni 2020 hat die Schweiz nach langjähriger Diskussion ein modernisiertes Aktienrecht erhalten, welches den veränderten gesellschaftlichen Bedürfnissen sowie den technologischen Entwicklungen gerecht werden kann. Die Bestimmungen des neuen Aktienrechts sind am 1. Januar 2023 in Kraft getreten. Einzig die neuen Geschlechterrichtwerte sowie die Transparenzregeln im Rohstoffsektor waren bereits auf den 1. Januar 2021 in Kraft getreten.
Klare Steigerung von Nachhaltigkeit und sozialer Verantwortung trotz Ablehnung der Konzernverantwortungsinitiative
Im neuen Aktienrecht ist ein wesentlicher Schritt Richtung nachhaltigere Entwicklung sowie erhöhte soziale Verantwortung von Aktiengesellschaften spürbar. Bereits seit dem 1. Januar 2021 haben Rohstoffunternehmen jährlich einen Bericht über Zahlungen an staatliche Stellen zu verfassen. Dabei handelt es sich um Unternehmen, die gesetzlich zu einer ordentlichen Revision verpflichtet und in den «Gebieten der Exploration, Prospektion, Entdeckung, Erschliessung und Förderung von Mineralien, Erdöl- und Erdgasvorkommen und des Einschlags von Holz in Primärwäldern» tätig sind. Daneben haben seit 1. Januar 2021 kotierte Aktiengesellschaften auch Geschlechterrichtwerte von mindestens je 30% im Verwaltungsrat (VR) und je 20% in der Geschäftsleitung zu beachten. Falls diese Quoten nicht erreicht werden, hat das Unternehmen zu begründen, weshalb die Geschlechter nicht ausreichend vertreten sind, und darzulegen, mit welchen Massnahmen das unzureichend vertretene Geschlecht gefördert wird (indes mit kulanter Übergangsfrist für Berichterstattungspflicht der Einhaltung bis Ende 2025 für VR und bis Ende 2030 für Geschäftsleitung).
Am 29. November 2020 hatten Schweizer Volk und Stände die Konzernverantwortungsinitiative aufgrund eines fehlendes Ständemehrs knapp abgelehnt. Faktisch ist dadurch jedoch der inhaltlich konkretere, indirekte Gegenvorschlag des Parlaments gutgeheissen worden. Dieser ist als Gesetz ausformuliert und wurde auf den 1. Januar 2022 in Kraft gesetzt.
Der hart geführte Wahlkampf um die Konzernverantwortungsinitiative, das äusserst knappe Resultat sowie auch die gesetzliche Formulierung des indirekten Gegenvorschlages zeigen deutlich, dass das neue Schweizer Aktienrecht zweifellos dem gemeinsamen Ziel von Initiative sowie auch Gegenvorschlag gerecht werden muss: Schweizer Unternehmen sollen Mensch und Umwelt auch im Ausland achten.
Zu diesem Zweck sind grosse Unternehmen des öffentlichen Interesses, die 500 Vollzeitstellen im Jahresdurchschnitt haben, neu dazu verpflichtet, einen jährlichen Nachhaltigkeitsbericht (Bericht über nichtfinanzielle Belange) zu erstellen (Art. 964a OR). Erstmals ist der Bericht für das Geschäftsjahr 2023 zu verfassen. Dieser Nachhaltigkeitsbericht hat aus Unternehmenssicht «Rechenschaft über Umweltbelange, insbesondere die CO2-Ziele, über Sozialbelange, Arbeitnehmerbelange, die Achtung der Menschenrechte sowie die Bekämpfung der Korruption» abzulegen (Art. 964b OR). Am 23. November 2022 hat der Bundesrat zudem eine Verordnung über die Berichterstattung über Klimabelange erlassen, welche die Berichterstattung von Unternehmen über Klimabelange als Teil der Umweltbelange konkretisierend regelt (AS 2022 747) und am 1. Januar 2024 in Kraft treten wird.
Ferner sind grundsätzlich unabhängig von der Unternehmensgrösse (der Bundesrat kann Erleichterungen für KMU vorsehen) Sorgfaltspflichten in der Lieferkette von Unternehmen und Transparenz zu beachten, wenn Mineralien oder Metalle aus Konfliktgebieten in der Schweiz bearbeitet oder in den Verkehr gebracht werden sowie wenn ein begründeter Verdacht besteht, dass ein angebotenes Produkt oder eine Dienstleistung unter Einsatz von Kinderarbeit zustande kam (Art. 964j ff. OR).DerDazu bestehen mit der Verordnung über Sorgfaltspflichten und Transparenz bezüglich Mineralien und Metallen aus Konfliktgebieten und Kinderarbeit (VSoTr) auch bereits detaillierte Ausführungsvorschriften. Der erste Bericht muss ebenfalls für das Geschäftsjahr 2023 erstellt werden.
Die neuen Vorschriften entsprechen dem europäischen Unionsrecht, im Bereich der Kinderarbeit sind sie noch weitergehend und haben sich der holländischen Regelung angelehnt.
Neue digitale Möglichkeiten
Vor dem 1. Januar 2023 waren rein digital abgehaltene Generalversammlungen (GV) nicht möglich, da damit das aktienrechtliche Unmittelbarkeitsprinzip verletzt worden wäre. Dieses Erfordernis der unmittelbaren physischen Anwesenheit wollte sicherstellen, dass ein Ort des tatsächlichen diskursiven Austausches, der Meinungsbildung sowie der Entscheidung der Aktionäre ermöglicht wird. Mit der Aktienrechtsrevision, die am 1. Januar 2023 in Kraft trat, sind jedoch neuerdings hybride wie auch rein virtuelle GVs explizit zugelassen. Analog ist nun das Prinzip der digitalen Unmittelbarkeit einzuhalten: Die Teilnehmer müssen elektronisch eindeutig identifiziert und die Voten elektronisch unmittelbar (ohne Zeitverzögerung) übertragen werden. Weiter muss auch jeder remote teilnehmende Aktionär Anträge stellen und an der Diskussion teilnehmen können. Schliesslich darf das Abstimmungsergebnis nicht verfälscht werden können. Auf diese Weise soll die gesellschaftliche Interaktion anlässlich der GV gleichermassen ermöglicht und die Idee der (nun digitalen) Landsgemeinde fortgeführt werden.
Alsdann ist auch das Wertpapierrecht noch digitaler geworden. Mit dem Bundesgesetz zur Anpassung des Bundesrechts an Entwicklungen der Technik verteilter elektronischer Register ist aber kein Distributed-Ledger-Technology-(DLT-)Gesetz geschaffen worden, sondern es wurden punktuelle Gesetzesänderungen vorgenommen (im OR, SchKG, IPRG, BEG und den Finanzmarktgesetzen inkl. NBG), um die Entwicklung der dezentralen elektronischen Registerführung, welche meist auf der Blockchain-Technologie basiert, in allen betroffenen Rechtsbereichen auch auf eine rechtliche Grundlage zu stellen. Die Technologie ist indes nicht auf DLT beschränkt, sondern kann auch andere Innovationen der digitalen Registerführung auffangen. Die digitalen Aktien der Zukunft sollen demnach sog. Registerwertrechte sein, welche nicht vertretbar sein müssen und im Gegensatz zu den einfachen Wertrechten echte Wertpapierfunktion erfüllen. Sie werden entsprechend nicht durch Zession, sondern durch Umbuchung im Register übertragen.
Vielzahl weiterer Neuerungen im Aktienrecht
Im Weiteren kennt das modernisierte Aktienrecht (seit 1. Januar 2023) eine Vielzahl weiterer Neuerungen. Bedeutend erscheint das neu eingeführte Kapitalband, mit welchem die Aktionäre dem Verwaltungsrat (VR) die Kompetenz erteilen können, das Aktienkapital (AK) während maximal fünf Jahren in einer limitierten Bandbreite (max. 150% AK, mind. 50% AK) zu erhöhen oder herabzusetzen. Damit können unternehmerische Eigenfinanzierungsentscheide für Projekte, Akquisitionen etc. stärker dem VR überantwortet werden. Voraussetzungen bilden eine statutarische Grundlage sowie das Unterliegen mindestens einer eingeschränkten Revision. Daneben sind weitere Flexibilisierungen bei den Kapitalvorschriften geschaffen, die Aktionärsrechte angepasst bzw. erweitert, zusätzliche bzw. spezifischere Pflichten des Verwaltungsrats eingeführt sowie die Bestimmungen des VegüV ins OR überführt worden.