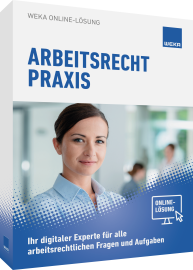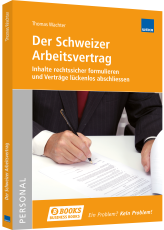Konkurrenzverbot: Darauf ist zu achten

Passende Arbeitshilfen
Im Arbeitsvertrag mit leitenden Angestellten wird oft ein nachvertragliches Konkurrenzverbot vereinbart, d.h. ein Konkurrenzverbot, das sich erst nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses aktualisiert. Sinn und Zweck des Konkurrenzverbots ist es, dass Arbeitnehmer, die weitgehenden Einblick in das Geschäft des Arbeitgebers hatten, davon abgehalten werden, nach ihrem Abgang dem alten Arbeitgeber Konkurrenz zu machen. Der Arbeitgeber wähnt sich in diesen Fällen in Sicherheit, dass der Arbeitnehmer ihn nicht konkurrenzieren wird, wenn er den Betrieb verlässt. In der Praxis zeigt sich allerdings, dass sich Konkurrenzverbote nicht immer so einfach durchsetzen lassen. Das kann daran liegen, dass die Voraussetzungen für das Konkurrenzverbot nicht erfüllt und/ oder die Konkurrenzverbote zu pauschal formuliert sind.
Gemäss Art. 340 Abs. 1 OR kann sich der handlungsfähige Arbeitnehmer gegenüber dem Arbeitgeber schriftlich verpflichten, nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses sich jeder konkurrenzierenden Tätigkeit zu enthalten, insbesondere weder auf eigene Rechnung ein Geschäft zu betreiben, das mit dem des Arbeitgebers in Wettbewerb steht, noch in einem solchen Geschäft tätig zu sein oder sich daran zu beteiligen.
Das Konkurrenzverbot ist allerdings nur verbindlich, wenn das Arbeitsverhältnis dem Arbeitnehmer Einblick in den Kundenkreis oder in Fabrikationsgeheimnisse gewährt und die Verwendung dieser Kenntnisse den Arbeitgeber erheblich schädigen könnte.
Das Konkurrenzverbot darf zudem das wirtschaftliche Fortkommen des Arbeitnehmers nicht unbillig erschweren, weshalb es nach Ort, Zeit und Gegenstand begrenzt werden muss (Art. 340a OR). Es zeigt sich in der Praxis oft, dass Konkurrenzverbote zu weitgehend formuliert sind, sodass es zu Streitigkeiten und womöglich zu Gerichtsprozessen kommt. Um dies möglichst zu verhindern, sollte der Eingrenzung des Konkurrenzverbots Beachtung geschenkt werden.
Voraussetzungen für die Geltung des Konkurrenzverbotes
Das Konkurrenzverbot ist nur möglich bei Arbeitnehmern, die Einblick in den Kundenkreis oder Fabrikations- und Geschäftsgeheimnisse haben. Ausserdem muss die Verwendung dieser Kenntnisse den Arbeitgeber erheblich schädigen. Hat ein Arbeitnehmer demnach keinen Einblick in den Kundenkreis, kann mit diesem kein gültiges Konkurrenzverbot vereinbart werden.
Der Einblick in eine Kundenliste (= Namen und Koordinaten) allein genügt gemäss Praxis nicht. Verlangt wird, dass der Arbeitnehmer einen persönlichen und direkten Kontakt zu den Kunden hat. Als Kunden gelten grundsätzlich die Abnehmer des Arbeitgebers und nicht Lieferanten oder Mitarbeiter, ebenso wenig potenzielle Kunden oder Interessenten.
Seminar-Empfehlungen
Welche Schranken muss ein Konkurrenzverbot beachten?
Das Konkurrenzverbot ist örtlich, zeitlich und sachlich einzugrenzen.
Örtliche Begrenzung: Das Konkurrenzverbot muss räumlich bestimmt werden, d.h., es ist festzulegen, in welchem Gebiet das Konkurrenzverbot gelten soll (z.B. Kanton Zürich, Deutschschweiz, im Umkreis von x km). Die Begrenzung darf nicht weiter gehen, als das Gebiet, auf welchem der Arbeitgeber überhaupt tätig ist. Führt das Konkurrenzverbot zu einem eigentlichen Berufsverbot (z.B. ganze Schweiz), dann wird das Konkurrenzverbot regelmässig in dieser Form nicht standhalten.
Zeitliche Begrenzung: Das Konkurrenzverbot darf von Gesetzes wegen für höchstens drei Jahre abgeschlossen werden. Unter besonderen Umständen ist eine Überschreitung der Dauer zulässig (dürfte in der Praxis schwierig durchzusetzen sein). In der Praxis begegnet man oft Konkurrenzverboten von 6 bis 24 Monaten.
Sachliche Begrenzung: Im Konkurrenzverbot ist zu erwähnen, welche Tätigkeit verboten ist (darf der Arbeitnehmer sich bei der Konkurrenz anstellen lassen, oder darf er sich selbstständig machen?). Die sachliche Begrenzung darf allerdings zu keinem Berufsverbot führen. Das Konkurrenzverbot darf im Übrigen nicht zu einer unbilligen Erschwerung des wirtschaftlichen Fortkommens des Arbeitnehmers führen.
Die Folgen der Verletzung
Verletzt der Arbeitnehmer ein arbeitsvertragliches Konkurrenzverbot, kann der Arbeitgeber den daraus erwachsenen Schaden verlangen und/oder eine vereinbarte Konventionalstrafe fordern. Die Beseitigung des vertragswidrigen Zustands kann der Arbeitgeber verlangen, wenn dies explizit vereinbart wurde (sog. Realexekution).
Die Konventionalstrafe kann gefordert werden, auch wenn kein Schaden entstanden ist! Das heisst, es ist sinnvoll, eine solche in der Konkurrenzklausel zu vereinbaren.
Was den Betrag betrifft, sollte man darauf achten, dass dieser nicht zu hoch angesetzt wird. Die Konventionalstrafe in der Höhe eines halben bis ganzen Jahressalärs wurde verschiedentlich von Gerichten akzeptiert. Letztlich ist immer der Einzelfall zu beurteilen. Ist der Betrag der Konventionalstrafe exorbitant hoch, oder steht dieser überhaupt nicht im Verhältnis zum Jahressalär des Mitarbeiters, dürfte der Betrag der Konventionalstrafe durch den Richter auf ein angemessenes Mass reduziert werden.
Die Realexekution, also Aufhebung des vertragswidrigen Zustands, kann nur verlangt werden, wenn das ausdrücklich vereinbart wurde. Die Hürden sind allerdings hoch, und prozessual ist die Realexekution oft schwierig durchzusetzen.