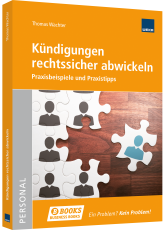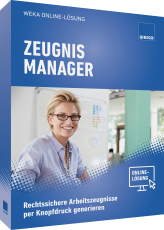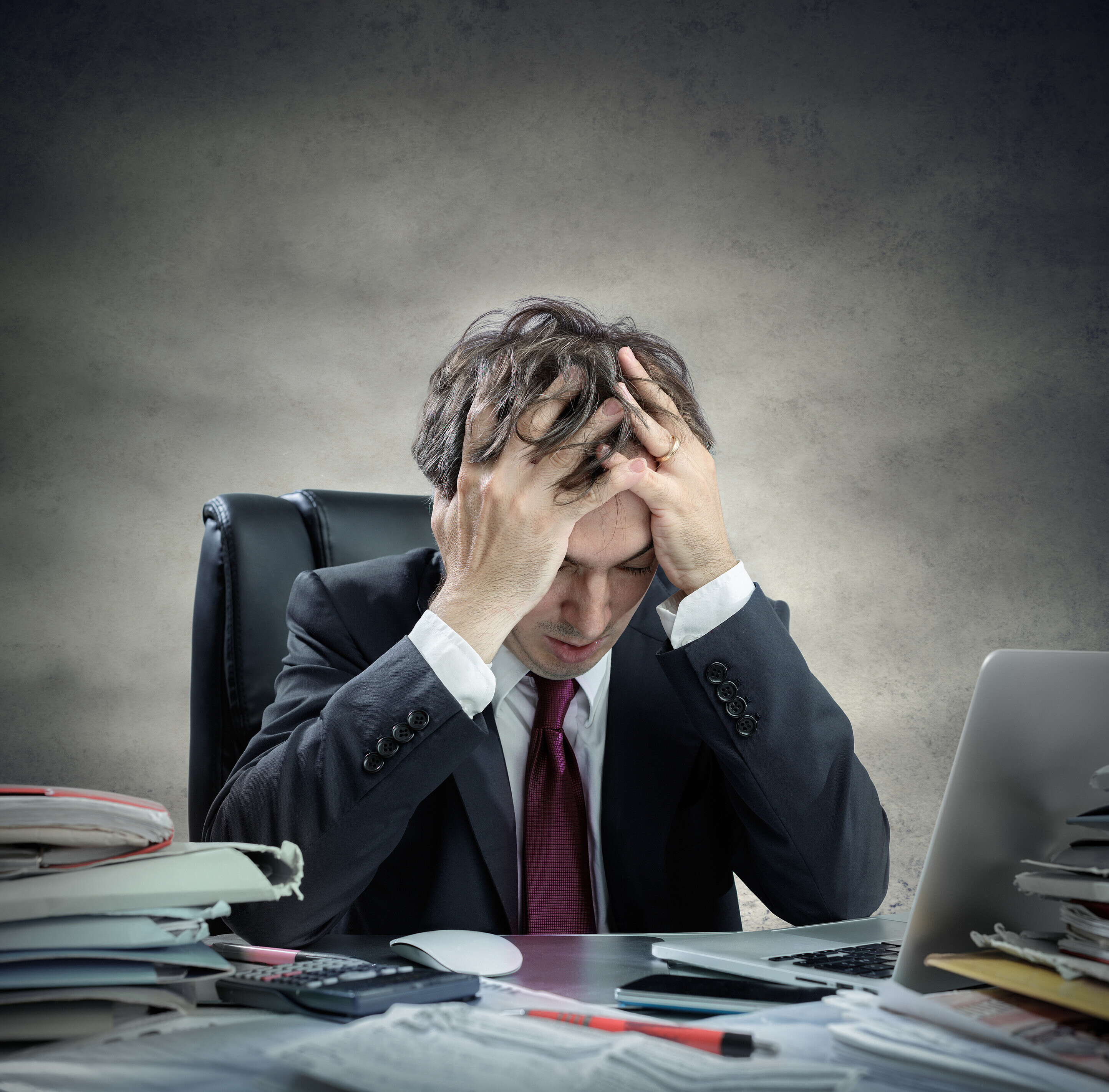Kündigung bei Krankheit: Sperrfristen und Lohnfortzahlung

Passende Arbeitshilfen
Darf während einer Krankheit gekündigt werden?
Als Ausgangspunkt dient Art. 336c Abs. 1 lit. b OR: Diese Bestimmung sieht vor, dass der Arbeitgeber nach Ablauf der Probezeit für eine bestimmte Zeit (sog. Sperrfrist) nicht kündigen darf, wenn der Arbeitnehmer ohne eigenes Verschulden durch Krankheit oder durch Unfall ganz oder teilweise an der Arbeitsleistung verhindert ist. Diese Sperrfrist bezieht sich auf Kalendertage und gilt im ersten Dienstjahr während 30 Tagen, ab dem zweiten bis und mit dem fünften Dienstjahr während 90 Tagen und ab dem sechsten Dienstjahr während 180 Tagen.
Entscheidend ist, dass der Arbeitnehmer nicht «nur» krank, sondern arbeitsunfähig ist, d.h. unfähig, die vertraglich geschuldete Arbeit zu erbringen. Der Beweis einer Arbeitsunfähigkeit wird durch Arztzeugnisse erbracht und bei Zweifeln hat der Arbeitgeber das Recht, auf seine Kosten eine Überprüfung der Arbeitsunfähigkeit durch einen Vertrauensarzt seiner Wahl zu verlangen.
Die Sperrfristen kommen mit gleicher Dauer auch bei Teilzeit- und Temporärarbeitsverhältnissen sowie bei Freistellung zum Tragen. Keine Anwendung findet der Kündigungsschutz bei befristeten Arbeitsverhältnissen und gerechtfertigten fristlosen Entlassungen.
Durch eine Aufhebungsvereinbarung kann das Arbeitsverhältnis jederzeit trotz Sperrfrist beendet werden, sofern die Aufhebungsvereinbarung die zwingenden Ansprüche des Arbeitnehmers (insbesondere die hypothetische Kündigungsfrist und deren Verlängerung aufgrund der Arbeitsunfähigkeit) angemessen vergütet.
Was sind die Folgen einer Kündigung bei Krankheit?
Art. 336c Abs. 2 OR sieht vor, dass die während der Sperrfrist aufgrund von Arbeitsunfähigkeit erfolgte Kündigung der Arbeitgeberin nichtig ist und daher nach dem Ablauf der Sperrfrist wiederholt werden muss. Ansonsten läuft das Arbeitsverhältnis weiter.
Umgekehrt ist die Kündigung gültig, wenn sie vor Eintritt der Arbeitsunfähigkeit ausgesprochen wird. Diesfalls wird die Kündigungsfrist während der Arbeitsunfähigkeit, höchstens aber bis zum Ablauf der maximalen Sperrfrist, unterbrochen und danach fortgesetzt. Läuft die konkrete Anzahl Tage der verbleibenden Kündigungsfrist schliesslich aus, wird auf das Ende des Kalendermonats aufgerundet (sofern nicht schriftlich eine Kündigung auf jedes Enddatum vereinbart wurde), an dem das Arbeitsverhältnis endet.
Entfällt die Arbeitsunfähigkeit vollumfänglich, so endet auch die Sperrfrist, selbst wenn deren gesetzliche Dauer noch nicht abgelaufen ist. In Ausnahmefällen kann die Berufung auf die Sperrfrist rechtsmissbräuchlich sein, etwa bei sehr kurzer Krankheit gegen Ende der Kündigungsfrist in Verbindung mit einer langen Freistellung bzw. dem Vorliegen einer neuen Stelle.
Passende Produkt-Empfehlungen
Mehrere Krankheitsfälle – verschiedene Sperrfristen?
Wird ein Arbeitnehmer während der Kündigungsfrist mehrere Male arbeitsunfähig, so kommt es darauf an, ob die Arbeitsunfähigkeit aus demselben Grund erfolgt oder nicht. Bei unterschiedlichen Gründen für die Arbeitsunfähigkeit, z.B. bei einem Beinbruch und anschliessender Grippe, finden zwei separate Sperrfristen Anwendung, die parallel laufen können. Dies gilt nur dann nicht, wenn die zweite Arbeitsunfähigkeit in die vorgenannte Aufrundung zum Monatsende gemäss Art. 336c Abs. 3 OR fällt. Ein Rückfall oder eine Folgeerscheinung derselben Krankheit lösen ebenfalls keine neue Sperrfrist aus. Bei einem Rückfall kann aber der Rest der noch nicht vollständig aufgebrauchten Sperrfrist in Anspruch genommen werden.
Dauert eine Krankheit über ein Dienstjahr hinaus, wird im neuen Dienstjahr kein neuer Anspruch auf eine Sperrfrist ausgelöst, da dieser Anspruch nur einmal pro Grund für die Arbeitsunfähigkeit gilt (eine Ausnahme kann aber nach gewissen Lehrmeinungen dann gelten, wenn zwischen den Arbeitsunfähigkeiten Jahre liegen). Allenfalls kommt aber beim Dienstjahreswechsel eine längere Sperrfrist zum Tragen (so beim Wechsel in das zweite und sechste Dienstjahr), abzüglich der bereits im vorherigen Dienstjahr abgelaufenen Tage der damals noch kürzeren Sperrfrist.
Verhältnis von Kündigungsschutz und Lohnfortzahlung
Während der durch die Sperrfrist verlängerten Kündigungsfrist hat der Arbeitnehmer nur Anspruch auf Lohn, wenn entweder eine Lohnfortzahlungspflicht gemäss Art. 324a/b OR vorliegt, wenn der Arbeitnehmer arbeitet, oder wenn er die Arbeit wegen Verzugs des Arbeitgebers nicht leisten kann. Wird der Arbeitnehmer während der verlängerten Kündigungsfrist wieder arbeitsfähig, muss er seine Arbeit anbieten, sonst verliert er grundsätzlich seinen Lohnanspruch.
Kündigungsschutz und Lohnfortzahlungspflicht gemäss Art. 324a OR sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Das Arbeitsverhältnis kann sich wegen der Sperrfrist z.B. um mehrere Monate verlängern, während die gesetzliche Lohnfortzahlungspflicht des Arbeitgebers bereits nach wenigen Wochen auslaufen kann. Die gesetzliche Lohnfortzahlungspflicht richtet sich ebenfalls nach Dienstjahren (die Gerichtspraxis arbeitet hier mit verschiedenen, Berner, Basler oder Zürcher Skalen), wobei der Anspruch aber in jedem Dienstjahr neu entsteht.
Frühzeitige Kündigungen
Arbeitgeber kündigen oft früher als am Ende eines Monats, um die rechtzeitige Gültigkeit der Kündigung sicherzustellen und den Arbeitnehmenden genügend Zeit für die Stellensuche einzuräumen. Wichtig ist dabei, dass die Gerichtspraxis die eigentliche Kündigungsfrist vom hypothetischen Ende des Arbeitsverhältnisses zurückrechnet. Wird beispielsweise bei einmonatiger Kündigungsfrist auf das Ende eines Monats eine Kündigung am 15. Mai per Ende Juni ausgesprochen, gilt lediglich der Juni als Kündigungsfrist im rechtlichen Sinne, welche durch eine Sperrfrist verlängert werden kann. Erkrankt also der Arbeitnehmer in diesem Beispielfall bereits im Mai, zählen zwar die Tage der Arbeitsunfähigkeit im Mai zur maximalen Sperrfrist, verlängern aber die Kündigungsfrist und damit das Arbeitsverhältnis nicht.